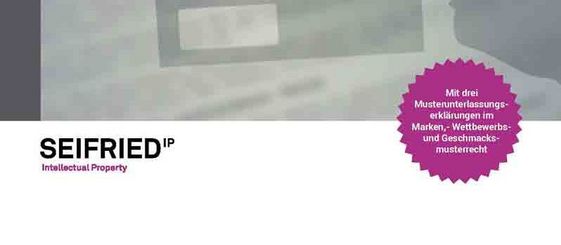Wer darf abmahnen? Die Aktivlegitimation
Aktivlegitimation des Markeninhabers
Ob jemand berechtigterweise eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung aussprechen kann, ist eine Frage der Aktivlegitimation. „Popularklagen", also die Wahrnehmung fremder Interessen in eigenem Namen, sieht das Markenrecht nur in Ausnahmefällen vor, nämlich in markenrechtlichen Löschungsverfahren. Sonst können nur Inhaber eigener Rechte Rechtsverletzungen geltend machen. Im Markenrecht sind dies die Markeninhaber und die Markenlizenznehmer. Im Markenrecht jedenfalls dürfen nur die Inhaber eigener originärer oder abgeleitetet Rechte abmahnen. Der Inhaber einer Marke, ist ohne weiteres gegenüber dem Markenrechtsverletzer aktivlegitimiert.
Aktivlegitimation des Markenlizenznehmers
Der Inhaber einer ausschließlichen und einer einfachen Lizenz an einer deutschen Marke ist zwar für den Unterlassungsanspruch, nicht aber für den Schadenersatzanspruch aktivlegitimiert. Denn ihm steht kein eigener Schadenersatzanspruch und auch kein eigener schadenersatzvorbereitender ("akzessorischer") Auskunftsanspruch gegen den Verletzer zu (BGH, Urteil v. 19.7.2007, I ZR 93/04 – Windsor Estate, Rz. 32). Das gleiche gilt für den Lizenznehmer einer Unionsmarke (vgl. BGH v. 13.9.2007, I ZR 33/05 – THE HOME STORE, Rn. 46). Ein Lizennehmer kann daher zwar in einer Abmahnung den Unterlassungsanspruch geltend machen, nicht aber Bezahlung des Schadenersatzes an sich selbst.
Auskunft und Schadensberechnungsmöglichkeiten bei der Verletzung von Marken
Üblicherweise berechnet der Verletzte in einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung seinen Schaden nach der Lizenzanalogie oder er berechnet den Verletzergewinn. Hierfür braucht er die Angaben des Verletzers. Der Abmahnende muss hier angeben, für welche Handlungen er Auskunft verlangt. Wenn er zusätzlich auch Rechnungslegung verlangt, muss er angeben, welche Rechnungen vorgelegt werden sollen. Wenn der Verletzte nur seinen eigenen konkreten Schaden ersetzt verlangt, muss keine Auskunft gegeben werden. Denn diesen Schaden kann der Verletzte ja selbst beziffern.
Erst wenn der Abgemahnte die Auskunft über den Umfang der Rechtsverletzung gegeben hat, kann der Abmahnende seinen Schaden berechnen. Wie der Schadensersatzanspruch besteht der Auskunftsanspruch grundsätzlich nur bei einer schuldhaften Rechtsverletzung des Abgemahnten.
Wie detailliert muss Auskunft gegeben werden?
Grundsätzlich muss der Verletzer über alle beanstandeten Rechtsverletzungen Auskunft geben. Eine zeitliche Begrenzung ab der ersten nachgewiesenen Verletzungshandlung gibt es seit der Entscheidung des BGH vom 19.07.2007, Az. I ZR 93/04 - Windsor Estate, nicht mehr (siehe auch BGH Urteil v. 30.04.2009, Az. I ZR 191/05 - Elektronischer Zolltarif). Der Abgemahnte muss auch grundsätzlich seine Vorlieferanten und seine gewerblichen Abnehmer angeben. Diese Auskunft ist für den Abmahnenden oft besonders interessant. So kann er sich Schritt für Schritt beispielsweise zum Hersteller eines Plagiats vorarbeiten. Oft erhöht auch die anschließende Abmahnung weiterer Glieder der Lieferantenkette die außergerichtliche Einigungsbereitschaft.
Der Abgemahnte muss grundsätzlich auch Rechnungen und sonstige übliche Unterlagen vorlegen über seine Einnahmen und Ausgaben, die die rechtsverletzenden Produkte betreffen. Wie detailliert der Abgemahnte Rechnung legen muss, richtet sich nach dem Einzelfall, insbesondere auch nach der Art des Unternehmens des Verletzers. So muss ein reines Vertriebsunternehmen - anders als der Hersteller eines Plagiats - meistens keine Angaben zu den Herstellungskosten machen.
TIPP: Um zu vermeiden, dass der Abgemahnte dem Abmahner, der zugleich sein Konkurent ist, seine Kunden offenbaren muss, kann der Abgemahnte einen sog. „Wirtschaftsprüfervorbehalt“ beanspruchen.
Der Umfang der Auskunft hängt schließlich auch davon ab, nach welcher Art der Verletzte seinen Schaden berechnen will. Außerdem begrenzen Geheimhaltungsinteressen und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz den Umfang des Auskunftsanspruchs (BGH v. 6.10.2005, I ZR 322/02 – Noblesse, Rz. 14).
Bei der sog. „Drittauskunft“ sind bei offensichtlicher Rechtsverletzung oder nach Klageerhebung auskunftspflichtig unter Umständen auch beispielsweise Spediteure, Lagerhalter oder die Betreiber von Onlineplattformen.
Worüber muss keine Auskunft gegeben werden?
Wer eine Markenrechtsverletzung begangen hat, muss für den selbständigen Auskunftsanspruch keine Auskunft über die Werbemittel oder die Anzahl der Klicks auf eine rechtsverletzende Anzeige geben. Denn diese Angaben werden in § 19 Abs. 3 MarkenG nicht genannt (BGH v. 14.07.2022 - I ZR 121/21 - Google Drittauskunft). Diese Auskünfte müssen u.U. aber für den akzessorischen, schadensersatzvorbereitenden Auskunftsanspruch gegeben werden.
Was passiert bei falscher Auskunft?
Kann der Verletzte nachweisen, dass der Verletzter falsch Auskunft gegeben hat, kann er den Verletzer zwingen lassen, erneut Auskunft zu geben und die Richtigkeit seiner Auskunft nun an Eides Statt zu versichern. Eine erneute Falschauskunft wäre dann strafbar.
Gegenabmahnung als "Retourkutsche"
Gelegentlich empfehlen Anwälte, den Abmahnenden selbst auf ein rechtsverletzendes Verhalten zu untersuchen, etwa indem man dessen Website "flöht". Eine anschließende Gegenabmahnung als "Retourkutsche", um anschließend mit den Kostenerstattungsansprüchen aufrechnen zu können, halten allerdings manche Gerichte für rechtsmissbräuchlich (z. B. LG München I, BeckRS 2008, 10678). Der BGH hält eine "Retourkutsche" aber nicht per se für rechtsmissbräuchlich.