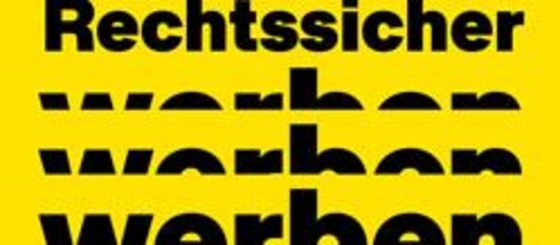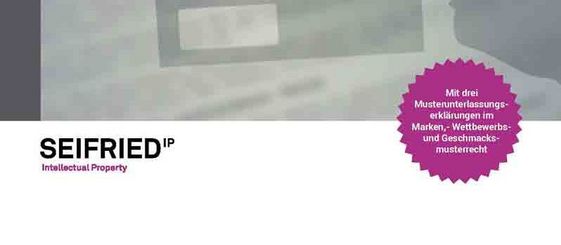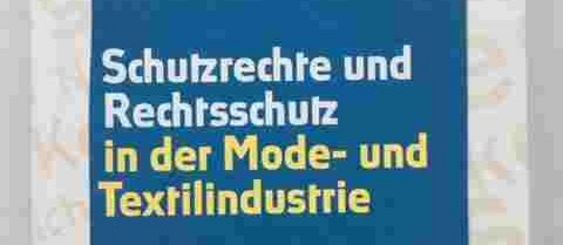Autor: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Haben Sie Fragen zum Kartellrecht?
Kostenlose Ersteinschätzung
Rufen Sie uns einfach unverbindlich an oder senden Sie uns eine Nachricht per Email oder über unser Kontaktformular. Wir antworten umgehend. Unsere erste Einschätzung ist kostenlos. Ihr Ansprechpartner: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Kostenlose Ersteinschätzung
Unsere telefonische Ersteinschätzung Ihres Falles ist kostenlos.
SEIFRIED IP
Eschersheimer Landstraße 60 - 62
60322 Frankfurt am Main
0 69 91 50 76 0
info@seifried.pro
Praktikerhandbuch zum Werberecht von Thomas Seifried
„Rechtssicher werben", 2. neubearbeite Auflage 2023, 232 Seiten, XchangeIP Verlag, im Buchhandel oder bei Amazon
Kostenloser Download "Abgemahnt - Die erste-Hilfe-Taschenfibel 2021" als ePUB oder PDF
Alles über Abmahnungen und strafbewehrte Unterlassungserklärungen
Praktikerhandbuch für die Modeindustrie von Thomas Seifried und Dr. Markus Borbach
„Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie", 368 Seiten, erschienen 2014 in der dfv-Mediengruppe
Kartellrechtlicher Belieferungsanspruch Fall 1:
OLG München v. 17.09.2015 – U 3886/14 Kart - Hetzenecker/Rimowa
Das Oberlandesgericht München hatte einem Koffereinzelhändler Recht gegeben und Rimowa zur kartellrechtlichen Belieferung verpflichtet. Geklagt hatte ein Einzelhändler, der in seinen Filialen Koffer und Taschen vertreibt. Bis 2012 vertrieb er auch „Rimowa“-Koffer. Den Händlervertrag aber hatte Rimowa gekündigt. Der Einzelhändler meinte, Rimowa müsse ihn dennoch beliefern. Rimowa-Koffer hätten auf dem Markt eine Spitzenstellung. Sie seien durch gleichartige Waren nicht zu ersetzen und er sei daher von diesen abhängig (sog. „Spitzenstellungsabhängigkeit“). Der Einzelhändler klagte auf Annahme eines „Händlervertrag zum selektiven Vertriebssystem 2011“. In zweiter Instanz gab das OLG München dem Einzelhändler Recht. Es verurteilte Rimowa, den Händlervertrag anzunehmen. Rimowa musste den Einzelhändler beliefern.
Der Einzelhändler habe einen Anspruch auf Abschluss eines Händlervertrags, weil er auf Rimowa-Koffer angewiesen sei, so das Oberlandesgericht. Diese Koffer müsse ein Facheinzelhändler führen, um wettbewerbsfähig zu sein. Rimowa-Koffer hätten eine Spitzenstellung auf dem „sachlich relevanten Markt“. Dabei hatte das Gericht den sachlich relevanten Markt eng definiert: Sachlich relevant sei nach dem „Bedarfsmarktkonzept“ nicht etwa der Markt für Koffer generell, sondern nur hochpreisige Koffer. Bei diesen stünden neben der Funktion vor allem Prestige- und Statuseffekte im Vordergrund. Diese unterschiedlichen Preissegmente bei Koffern würden auch durch verschiedene GfK-Studien belegt. In einer dieser GfK-Studien war der Marktanteil der Rimowa-Koffer im Bereich über € 400,00 mit 95% angegeben.
Als nächstes prüfte das OLG, ob der Einzelhändler von Rimowa-Koffern abhängig sei (vgl. § 19 Abs. 1 S. 1 GWB). Im Wesentlichen fragt man hier, ob es zumutbare Ausweichmöglichkeiten gibt. Solche Ausweichmöglichkeiten hatte das Gericht verneint. Rimowa-Koffer verfügten über eine hervorragende Qualität und ein einmaliges Design. Darauf hatte Rimowa in dem Verfahren sogar selbst hingewiesen. Rimowa-Koffer würden auch umfangreich beworben. Die Distributionsrate sei hoch gewesen. Die Koffer seien in nahezu jedem Fachgeschäft erhältlich gewesen. Fehlten diese Koffer in einem Angebot, so würde dies zu einem „Verlust an Ansehen“ führen. Einzelhändler wie die Klägerin seien daher auf diese Koffer angewiesen. Einen sachlich gerechtfertigten Grund für die Nichtbelieferung gebe es nicht. Die Weigerung, den Einzelhändler zu beliefern, sei daher ein Missbrauch einer relativen Marktmacht nach §§ 19 Abs. 2 Nr. 1, 20 Abs. 1 GWB dar.
Kartellrechtlicher Belieferungsanspruch Fall 2: BGH v. 6.10.2015 – KZR 87/13 – Porsche-Tuning
Liefern musste nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs auch Porsche. Geklagte hatte hier ein Porsche-Tuner, der darauf bestand mit Neuwagen beliefert zu werden, damit er diese ausstellen kann. Geklagt hatte ein Tuner von Porsche-Fahrzeugen. Dieser hatte die Fahrzeuge und Fahrzeugteile – bis zu einem Motorendiebstahl im Jahr 2007 – von Porsche bezogen. Den gestohlenen Motor hatte der Porsche-Tuner gekauft und für einen Tag auf sein Betriebsgelände gebracht. Die Turboladeraggregate dieses Motors waren in einen anderen Wagen eingebaut worden. Wegen dieses „Motorenvorfalls“ hatte Porsche die Geschäftsbeziehung beendet. Der Porsche-Tuner war der Ansicht, er bauche Porsche-Neufahrzeuge, um diese für seine Umrüstprogramme präsentieren zu können. Es sei daher von diesen abhängig. Ebenso brauche er Original-Porsche-Teile.
Der Kartellsenat des BGH gab dem Porsche-Tuner letztendlich Recht: Porsche sei beim Vertrieb von Porsche-Neufahrzeugen marktbeherrschend. Einem Porsche-Tuner sei es auch nicht zuzumuten, auf andere Automarke auszuweichen. Er sei daher von Porsche abhängig. Der Porsche Tuner brauche die Neufahrzeuge auch, um seine Produkte angemessen präsentieren zu können. Eine Nichtbelieferung sei eine unbillige Behinderung. Auf den „Motoren-Vorfall“ könne sich Porsche nicht berufen. Der läge ja schon immerhin acht Jahre zurück. Auch die Nichtbelieferung mit Porsche-Ersatzteilen sei eine unbillige Behinderung. Das würde den Porsche-Tuner zumindest beeinträchtigen, weil er kein Tuning mehr anbieten könne, für das er Original-Porscheteile benötige.
Wann müssen Markenhersteller liefern?
Grundsätzlich besteht Vertragsfreiheit. Ein Unternehmen kann grundsätzlich ohne Angaben von Gründen entscheiden, mit wem es Geschäftsbeziehungen eingehen will (BGH v. 24.06.2003 – KZR 32/01; LG Düsseldorf v. 21.07.2011 – 14c O 117/11). Es gibt keinen gesetzlichen Zwang, jeden Händler, der dies möchte, beliefern zu müssen. Ausnahmen hiervon sind aber die oben dargestellten kartellrechtlichen Belieferungsansprüche.
Abhängigkeit und zumutbare Ausweichmöglichkeiten?
Zentraler Gesichtspunkt ist hier die „Abhängigkeit“ i.S.d. § 20 Abs. 1 GWB. Eine solche Abhängigkeit setzt voraus, dass es zumutbare Ausweichmöglichkeiten auf andere (vergleichbare) Produkte nicht gibt. Mangelnde Ausweichmöglichkeiten gibt es – neben den oben dargestellten Beispielen - auch für die Fachbücher eines führenden juristischen Fachverlags nicht (OLG Karlsruhe v. 14.11.2007 – 6 U 57/06 – Belieferungsanspruch eines Versandbuchhändlers) und für Vertragshändler, die ihren Geschäftsbetrieb auf ganz bestimmte Produkte eingerichtet haben (vgl. OLG Frankfurt v. 04.02.2014 – 11 U 22/13 (Kart).
Selektives Vertriebssystem als sachliche Rechtfertigung einer Nichtbelieferung
Eine Nichtbelieferung kann dennoch „sachlich gerechtfertigt“ sein. Eine solche Rechtfertigung kann ein zulässiges selektives Vertriebssystem sein. Wer beispielsweise Markenparfums vertreibt, darf zulässigerweise den Internethandel an die Einrichtung eines stationären Fachgeschäfts knüpfen, in dem die Kunden beraten werden und die Parfums ausprobiert werden können. Selbst ein zwar nicht marktbeherrschender aber doch marktführender Hersteller von Markenkosmetik (JOOP!, Lancaster, Jil Sander, Davidoff), der ein selektives Vertriebssystem unterhält, ist daher nicht verpflichtet, einen reinen Onlinehändler für Kosmetikartikel zu beliefern (BGH v. 4.11.2003 – KZR 2/02 – Depotkosmetik im Internet). Dabei können selektive Vertriebssysteme auch den Onlinevertrieb beispielsweise über Amazon wirksam beschränken.