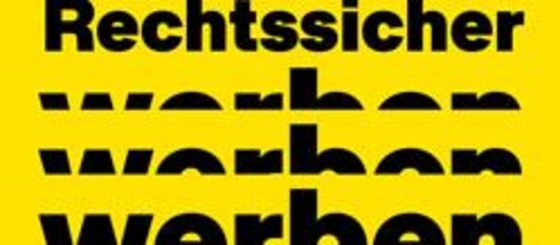Autor: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Haben Sie Fragen?
Ihr Ansprechpartner: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und seit 2007 Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, hat über 20 Jahre Erfahrung mit Abmahnungen und strafbewehrten Unterlassungserklärungen.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Wir melden uns umgehend
0800 8765544
(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)
Wir behandeln alle Unterlagen streng vertraulich.
Unsere Ersteinschätzung ist stets kostenlos.
Praktikerhandbuch zum Werberecht von Thomas Seifried
„Rechtssicher werben", 2. neubearbeite Auflage 2023, 232 Seiten, XchangeIP Verlag, im Buchhandel oder bei Amazon
Namensrecht und Kennzeichenrecht
Das Verhältnis von Namensrecht zu Unternehmenskennzeichen und Marken
Im Namensrecht geht es im Wesentlichen um Namen von natürlichen Personen. Auch Unternehmen können zwar grundsätzlich Namensrechte besitzen, hier geht aber meistens das Kennzeichenrecht (z.B. das Markenrecht) vor. Eine wichtige Ausnahme ist die Verletzung des Namensrechts durch Registrierung von Domains (s.u.).
Als Unternehmenskennzeichen geschützt ist eine Bezeichnung an sich nur gegenüber der Verwendung für zumindest ähnliche Branchen. Außerhalb der Branchenähnlichkeit ist die Bezeichnung aber als Name geschützt, wenn Sie identisch oder „nahezu identisch“ benutzt wird und dabei eine „Zuordnungsverwirrung“ entsteht (BGH, Urteil v. 9.11.2011 – I ZR 150/09 – Basler Haar-Kosmetik). Gemeint ist damit eine Verwirrung über den Namensträger.
Ausnahme: Nicht konnektierte Domain
Namensrecht neben Kennzeichenrecht anwendbar
Die Bestimmung des § 12 BGB wird nach höchstrichterlicher Rechtsprechung durch das Kennzeichenrecht nicht verdrängt, sondern ist daneben anwendbar, wenn der Funktionsbereich des Unternehmens ausnahmsweise durch eine Verwendung der Unternehmensbezeichnung außerhalb der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr berührt wird oder wenn mit der Löschung des Domainnamens eine Rechtsfolge begehrt wird, die aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften grds. nicht hergeleitet werden kann (BGH MMR 2012, 233 – Basler Haar-Kosmetik).
Wörtlich heißt es in dem Urteil BGH MMR 2012, 233, Rz. 31 ff. – Basler Haarkosmetik:
„Der Anspruch aus § 12 BGB wird im Streitfall nicht durch die Bestimmungen der §§ 5, 15 MarkenG verdrängt.
[...] Der Kennzeichenschutz aus §§ 5, 15 MarkenG verdrängt in seinem Anwendungsbereich zwar den Namensschutz aus § 12 BGB. Die Bestimmung des § 12 BGB bleibt jedoch anwendbar, wenn der Funktionsbereich des Unternehmens ausnahmsweise durch eine Verwendung der Unternehmensbezeichnung außerhalb der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr berührt wird. In solchen Fällen kann der Namensschutz ergänzend gegen Beeinträchtigungen der Unternehmensbezeichnung herangezogen werden, die nicht mehr im Schutzbereich des Unternehmenskennzei-chens liegen (BGH, a.a.O. – mho.de; BGH, a.a.O., Rdnr. 10 – afilias.de). Entsprechendes gilt, wenn mit der Löschung des Domainnamens eine Rechtsfolge begehrt wird, die aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften grds. nicht hergeleitet werden kann (Ingerl/Rohnke, MarkenG, nach § 15 Rdnr. 65). “
Anspruch auf Löschung einer Domain
Die Löschung eines ein Unternehmenskennzeichen verletzenden Domainnamens kann daher aus § 12 BGB hergeleitet werden, weil mit der Löschung des Domainnamens eine Rechtsfolge begehrt wird, die aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften nicht hergeleitet werden kann. Mit anderen Worten: Weil auf ein Kennzeichen ein genereller und unabhängig von einer konkreten kennzeichenverletzenden Nutzung gerichteter Löschungsanspruch nicht gestützt werden kann, hilft hier das Namensrecht, so der BGH.
Ausnahmsweise schützenswerte Interessen des Domaininhabers können einem namensrechtlichen Löschungsanspruch aber entgegenstehen.
Beispiele:
Die Registrierung des Domainnamens durch den nichtberechtigten Domaininhaber ist nur der erste Schritt, um zulässigerweise ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen für einen Betrieb zu nutzen (BGH v. 9.9.2004 – I ZR 65/02 – mho.de).Das Kennzeichen- oder Namensrecht des Berechtigten ist erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Domaininhaber entstanden (BGH v. 6.11.2013 – I ZR 153/12 – sr.de).
Anwendungsbereich des Namensrechts bei Domains
Im geschäftlichen Bereich wird das Namensrecht vom Marken- und Kennzeichenrecht verdrängt. Das Namensrecht schützt eine Bezeichnung außerhalb des geschäftlichen Bereichs, also dann, wenn ein Name überhaupt nicht geschäftlich genutzt wird. Das ist z.B. bei Privatpersonen der Fall. Das Namensrecht kann aber auch ein Unternehmenskennzeichen dort ergänzen, wo der Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht mehr hinreicht. Als Unternehmenskennzeichen geschützt ist eine Bezeichnung nämlich nur gegenüber der Verwendung für zumindest ähnliche Branchen. Außerhalb der Branchenähnlichkeit ist die Bezeichnung aber namensrechtlich geschützt (BGH, Urteil v. 24.4.2008 – I ZR 159/05 – afilias.de).
Inhaber von Zweibuchstabendomain „Ki.de“ muss Domain freigeben - BGH v. 14.07.2017 - I ZR 202/16 - ki.de
Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen
Inhaber der Domain ki.de war eine Gesellschaft in Florida. Die Gesellschaft selbst betreibt - außer dem Halten dieser Domain - kein Geschäft. Der President dieser Gesellschaft führt außerdem noch dutzende weitere Gesellschaften, die allesamt Inhaber von zwei- oder dreistelligen Domains sind.
Die von uns vertretene Klägerin verlangte die Freigabe dieser Domain und berief sich dabei auf ihr Namensrecht an der Bezeichnung „KI“. Sie betrieb einen Verlag und nutzt dabei „KI“ seit Jahren auch als Abkürzung für diesen Verlag. Nachdem verschiedene Versuche, die Klageschrift zuzustellen scheiterten, wurde die öffentliche Zustellung der Klage angeordnet. Am 27.11.2012 wurde die Beklagte per Versäumnisurteil verurteilt, in die Löschung der Klage einzuwilligen. Nach Kündung der Domain durch die DENIC fiel die Domain aufgrund eines zwischenzeitlich gestellten Dispute-Eintrags an die Klägerin.
Am 4.4.2013 beantragte die Beklagte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Klage sei nicht wirksam zugestellt worden. Die Bezeichnung „KI“ würde man auch ohne weiteres als „Künstliche Intelligenz“ verstehen. Es läge daher keine Namensrechtsverletzung vor. „KI“ sei vielmehr Gattungsbezeichnung. Schließlich erhob die Beklagte Widerklage auf Einwilligung in die Rückübertragung der Domain.
Namensrecht an Äbkürzungen?
Das erstinstanzliche Landgericht Frankfurt hatte den Widereinsetzungsantrag als begründet angesehen. Es hat aber die Beklagte dennoch zur Freigabe der Domain verurteilt. Der Klägerin stünde ein Namensrecht an der Bezeichnung „KI“ zu. Die Bezeichnung sei für einen Verlag originär unterscheidungskräftig. Durch Nutzung der Firmenabkürzung „KI“ sei ein Namensrecht an dieser Bezeichnung entstanden. Schließlich habe sich die Beklagte durch Registrierung der Domain auch unberechtigt diesen Namen angemaßt. Schutzwürdige Interessen der Beklagten seien nicht erkennbar. Eigene Rechte der Beklagte seien nicht erkennbar, weil die Domain nie konnektiert war, d.h. nie benutzt wurde.
„ki“ beschreibend für „künstliche Intelligenz“?
Einer namensmäßigen Verwendung stehe auch ein beschreibender Inhalt als Abkürzung des Begriffs „künstliche Intelligenz“ nicht entgegen. Dass im Duden unter „ki“ die Bedeutung „künstliche Intelligenz“ verzeichnet sei, ändere daran nichts. Denn unter dem Eintrag „ki“ seien auch andere denkbare Bedeutungen der Abkürzung verzeichnet, so das LG Frankfurt. Weil die Beklagte auch keine eigenen Rechte an der Bezeichnung „ki“ habe, wurde die Widerklage abgewiesen.
Gegen das Urteil legte die Beklagte Berufung ein. Auch diese blieb laut Urteil des OLG Frankfurt v. 10.03.2016 - 6 U 12/15 - ki.de - erfolglos. Das Oberlandesgericht Frankurt stellte klar, dass ein namensmäßiger Gebrauch und damit eine Namensrechtsverletzung nur dann ausscheide, wenn man den Domainnamen ausschließlich als Gattungsbezeichnung im Sinne von „künstlicher Intelligenz“ verstehe. Das sei aber nicht der Fall. Denn die Abkürzung könne auch andere beschreibende Bedeutungen, wie etwa „Kiefer“, „Kilo“ oder „Kreisinspektor“. Darüber hinaus könne man „KI“ eben auch als nicht beschreibende Bedeutungen ansehen. Die Revision wurde nicht zugelassen.
Gegen das Urteil legte die Beklagte Nichtzulassungsbeschwerde vor dem BGH ein. Diese wurde vom BGH mit Beschluss vom 14.06.2017 - I ZR 202/16 - zurückgewiesen. Die kurze Begründung: Die Rechtssache habe keine grundsätzliche Bedeutung und eine Entscheidung des BGH sei auch nicht zur Fortbildung des Rechts erforderlich.
Löschungsanspruch schon bei Registrierung der Domain, nicht erst bei Benutzung
Schon mit der Domainregistrierung und nicht erst mit der Benutzung der Domain erstreckt sich nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ein gleichlautender Name einer Person oder eines Unternehmens auch auf diese Domain. Dieses Namensrecht (§ 12 BGB) berechtigt den Inhaber, von dem Inhaber einer anderen „nahezu gleichlautenden“ Domain, die Löschung zu verlangen, wenn der Inhaber der anderen Domain keine „schutzwürdigen Interessen“ vorweisen kann (BGH Urteil v. 9.11.2011 - I ZR 150/09 – Basler Haar-Kosmetik), was die Rechtsprechung meistens bejaht.
Anforderungen an die Ähnlichkeit bei Namensrechtsverletzung - Zuordnungsverwirrung
Die Anforderungen an die Ähnlichkeit des Namens mit der potenziell rechtsverletzenden Domains sind höher als bei Marken- oder Unternehmenskennzeichen. Es muss sich um den gleichen oder nahezu gleichen (vgl. BGH Urteil v. 9.11.2011 - I ZR 150/09 – Basler Haar-Kosmetik) Namen handeln. Ein beschreibender Domainbestandteil wie etwa „Landgut“ in einer Domain „landgut-borsig.de“ bleibt unberücksichtigt (BGH Urteil v. 20.10.2009 – I ZR 173/07 – Landgut Borsig).
Durch die Namensgleichheit muss es zu einer „Zuordnungsverwirrung“ kommen. Gemeint ist dabei eine Verwirrung darüber, wem der Namen tatsächlich zugeordnet ist. Außerdem müssen „schutzwürdige Interessen“ des Namensinhabers verletzt werden, was die Rechtsprechung bei Domains im Allgemeinen bejaht (vgl. BGH, Urteil v. 22.11.2001 – I ZR 138/99 – shell.de).
Ausnahmen: Keine Namensrechtsverletzung bei Branchenverschiedenheit oder Priorität
Hiervon gibt es aber zwei Ausnahmen. Erste Ausnahme: Der Domaininhaber möchte die Domain zur Kennzeichnung seines eigenen – branchenverschiedenen - Unternehmens nutzen.
Beispiel
Das „Marienhospital Osnabrück“ verwendete die Abkürzung „MHO“. Die Werbeagentur „Medienhaus Osnabrück“ registrierte die Domain „mho.de“, um darunter Datenbanken für Kunden einzurichten. Zwar wurde die Do-main erst nach Entstehung des Namensrechts des Marienhospitals regis-triert. Die Registrierung war aber dennoch zulässig. Denn die Nutzung eines gleichlautenden Unternehmenskennzeichens ist in unterschiedlichen Branchen ja zulässig (BGH v. 9.9.2004 – I ZR 65/02 – mho.de).
Zweite Ausnahme: Das potenziell verletzte Namensrecht ist erst nach der Registrierung der Domain entstanden. Auch in diesem Fall ist, scheidet eine Namensrechtsverletzung aus (Vgl. BGH v. 6.11.2013 – I ZR 153/12 – sr.de).
Anspruch nur auf Löschung der Domain, nicht aber auf Übertragung
Wer in seinem Namensrecht verletzt ist, kann grundsätzlich die Löschung der Domain verlangen (BGH Urteil v. 9.11.2011 – I ZR 150/09 – Basler Haar-Kosmetik). Eine Übertragung kann er aber nicht verlangen. Bei den bei der DENIC registrierten .de-Domains fällt aber eine gelöschte Domain automatisch an den Rechtsinhaber, wenn er zuvor einen DISPUTE-Antrag gestellt hat. So kommt der Namensrechtsinhaber letztendlich doch an die gelöschte Domain.
Umfassende Berücksichtigung der Interessen des Domaininhabers
Bei der Prüfung einer unberechtigten Namensanmaßung durch die Aufrechterhaltung einer vor Entstehung des Namensrechts registrierten Internetdomain (hier: energycollect.de) sind nicht nur spezifisch namens- oder kennzeichenrechtliche, sondern sämtliche Interessen des Domaininhabers an der Aufrechterhaltung der Domainregistrierung zu berücksichtigen, deren Geltendmachung nicht rechtsmissbräuchlich ist. Hierzu zählt auch ein wirtschaftliches Interesse an der Fortführung einer Weiterleitung, um durch eine Verbesserung der Trefferquote und des Rankings der Zielseite in Suchmaschinen das Besucheraufkommen zu erhöhen (BGH , Urteil v. 26.10.2023 - I ZR 107/22 - energycollect.de).
Beiträge von Rechtsanwalt Thomas Seifried zum Domainrecht auf heise.de
- heise.de: "Eine Domain ist keine Marke Teil III"
Rechtsanwalt Thomas Seifried über rechtsverletzende Domains - heise.de: "Eine Domain ist keine Marke Teil II"
Rechtsanwalt Thomas Seifried über das Domainnamensrecht, das Domainkennzeichenrecht und die Übertragung von Domains - heise.de: "Eine Domain ist keine Marke"
Rechtsanwalt Thomas Seifried über die Rechtsnatur von Domains und die Entstehung von Schutzrechten an Domainnamen