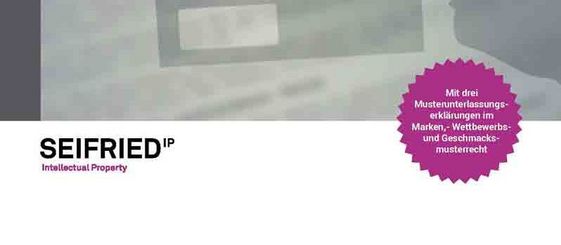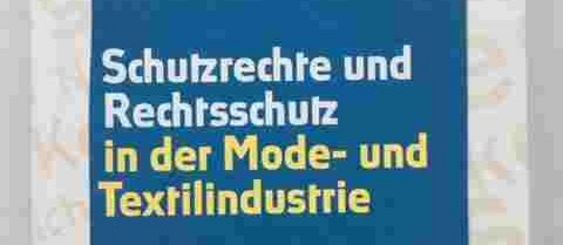Autor: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Ihr Rechtsanwalt
Kostenlose Ersteinschätzung
Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Thomas Seifried, seit 2007 auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, hat über 20 Jahre Erfahrung im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Designrecht mit vielen nachweisbaren Erfolgen.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Wir melden uns umgehend
0800 8765544
(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)
Wir behandeln alle Unterlagen streng vertraulich.
Unsere Ersteinschätzung ist stets kostenlos.
Kostenloser Download "Abgemahnt - Die erste-Hilfe-Taschenfibel"
Alles über Abmahnungen und strafbewehrte Unterlassungserklärungen, mit Musterformularen
Praktikerhandbuch für die Modeindustrie von Thomas Seifried und Dr. Markus Borbach
„Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie", 368 Seiten, erschienen 2014 in der dfv-Mediengruppe
Die Haftung als Täter - "Zu eigen machen von Inhalten"
Beiträge auf virtuellen Marktplätzen, in Themenforen, Kommentare oder Blogs aber auch Verkaufsangebote auf Handelsplattformen, werden vom Nutzer eingestellt. Der Plattformbetreiber bekommt Traffic, Provisonen oder Werbeerlöse. Im Gegenzug gibt es Umsatz oder jedenfalls Aufmerksamkeit, Anerkennung und das Gefühl, zu einer „Community" zu gehören. Verkaufsplattformen, Blogs, Foren, Ratgeber-Communities und Social Networks leben vom „Mitmachweb". Schnell können dabei Rechte verletzt werden: Woher die Texte, Bilder, Videos oder Logos tatsächlich stammen, kann der Plattformbetreiber kaum überprüfen. Verstöße gegen das Urheberrecht, das Markenrecht oder das Wettbewerbsrecht sind für viele Plattformbetreiber tägliches Geschäft. Viele Foren und Blogs erlauben außerdem anonyme oder pseudonyme Beiträge und Kommentare. Impulsive Naturen erleichtern sich dort oft mit persönlichen Beleidigungen oder Verunglimpfungen. Der Betroffene mag sich da fragen, ob er nicht direkt gegen den Plattformbetreiber vorgehen kann, als gegen eine anonymen oder pseudonymen Nutzer. Wer eine solche Plattform betreibt, steht daher vor der Frage, wer für Inhalte, die Nutzer erstellen, haftet.
Inhalte „zu eigen machen" – die Haftung als „Täter" für fremden Content
Als „Täter" einer Rechtsverletzung haftet ein Plattformbetreiber, wenn er sich die von den Nutzern generierten Inhalte „zu eigen macht". „Zu eigen machen" heißt: Fremde Inhalte werden dem Plattformbetreiber aufgrund bestimmter Umstände als eigene zugerechnet. Fremder Content wird also behandelt, also ob er selbst erstellt worden wäre. Hierfür werden Indizien herangezogen. Man fragt also: Indentifiziert sich der Plattformbetreiber mit den fremden Inhalten und hat er diese so das eigene Angebot integriert und verwertet, dass er die „inhaltliche Verantwortung" übernommen hat? Wer z.B. als Plattformbetreiber die von den Nutzern hochgeladenen Beiträge und Fotos konsequent mit dem eigenen Logo kennzeichnet, übernimmt unter Umstände die inhaltliche Verantwortung für diese eingestellten Inhalte (so in dem Fall BGH Urteil v. 12.11.2009 – Az. I ZR 166/07 – marions-kochbuch.de).
Weitere Indizien: In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Plattformbetreiber umfassende Nutzungsrechte zur wirtschaftlichen Verwertung eingeräumt, der Plattformbetreiber übernimmt die redaktionelle Verantwortung, indem er die Inhalte erst nach einer Überprüfung freischaltet. Dass man den Inhalt als fremd kennzeichnet, schützt nicht vor einer solche Zurechnung. Die Konsequenzen können gravierend sein: Der Betreiber muss nicht nur künftige Rechtsverletzungen verhindern und dem in seinen Rechten Verletzten die erforderlichen Kosten einer Abmahnung (siehe hierzu: Abmahnkosten)
Fremder Content bleibt fremd – die Haftung als „Störer"
Auch wenn sich der Betreiber einer Internetplattform die dort veröffentlichten Inhalte nicht zu eigen macht, droht immer noch die Haftung als sog. „Störer". Ein Störer muss zwar nur dafür sorgen, dass die Rechtsverletzung gelöscht und künftige Rechtsverletzungen verhindert werden. Er haftet aber grundsätzlich nicht für die durch die Rechtsverletzung entstandenen Schäden. Auch Kosten einer Abmahnung muss er regelmäßig nicht erstatten.
Grundsatz: Keine Prüfpflicht ohne Anlass
Der Bundesgerichtshof betont immer wieder, dass ein Plattformbetreiber ohne Anlass seine Plattform nicht ständig auf mögliche Rechtsverletzungen überprüfen muss (z. B. BGH Urteil vom 17.12.2010 – Az. V ZR 44/10). Eine solche Prüfpflicht wäre mit einem an sich zulässigen Geschäftsmodell nicht vereinbar und widerspräche auch Europäischem Recht.
Von dem Zeitpunkt an, an dem er von einer Rechtsverletzung erfährt, etwa durch eine Abmahnung oder einen Schutzrechtshinweis, ist der Plattformbetreiber „Störer". Er muss nun alles ihm zumutbare tun, um weitere Rechtsverletzungen zu verhindern. Er muss die rechtsverletzenden Inhalte löschen, auf die er hingewiesen wurde und muss dafür sorgen, dass künftig „gleichartige" Rechtsverletzungen nicht mehr vorkommen.
Der Aufwand hierfür kann beträchtlich werden. Wer z. B. als Plattformbetreiber auf eine markenrechtsverletzendes Verkaufsangebot hingewiesen wurde, muss nämlich nicht nur dafür sorgen, dass dieses Angebot gelöscht wird. Löschen muss er auch vergleichbare markenrechtsverletzende Produktangebote derselben Marke. Tut er dies nicht, kann derjenige, dessen Rechte durch die Plattforminhalte erneut verletzt werden, dem Plattformbetreiber gerichtlich verbieten lassen, diese Rechtsverletzung zu ermöglichen.
Zur Prüfpflicht für Betreiber von Meinungsforen hat sich der Bundesgerichtshof bisher nicht geäußert. Hier kann die Form rechtsverletzender Äußerungen theoretisch unendlich viele Gestalten annehmen. Der Einsatz einer Suchsoftware wird daher schon deswegen keinen Erfolg versprechen, weil hier nicht klar ist, wonach gesucht werden soll. Anders kann es sein, wenn sich eine weitere Rechtsverletzung in einem bestimmten Forum zu wiederholen droht. Das OLG Hamburg verlangte vor einigen Jahren, dass bei einem Aufruf in einem Forum, einen bestimmten Server durch viele Downloads in die Knie zu zwingen, der Forumsbetreiber künftig jedenfalls den betroffenen Thread auf vergleichbare Aufrufe hin überprüfen muss (OLG Hamburg MMR 2006, 744 – heise.de).
Umfang der Prüfpflicht - der „Einzelfall"
Wie umfangreich zu prüfen ist, entscheidet demnach der berühmte „Einzelfall". Einige Grundregeln zeichnen sich ab:
Je eher Rechtsverletzungen möglich sind, desto umfangreicher und intensiver muss künftigen Rechtsverletzungen vorgebeugt werden. Wer also beispielsweise seine Nutzer anonym oder pseudonym agieren lässt, muss umfangreichere Vorkehrungen treffen als derjenige, der die Identität seiner Nutzer überprüft. Umgekehrt müssen dort weniger Vorkehrungen getroffen werden, wo Hemmschwellen oder Kontrollmechanismen eingebaut werden. Solche Kontrollmechanismen könnten etwa Pflichtangaben über die Inhaberschaft an Rechten an den eingestellten Inhalten sein.
Die Prüfung darf aber nicht technisch oder wirtschaftlich unzumutbar werden. Unzumutbar ist nach der Rechtsprechung in der Regel eine Prüfung, die ausschließlich aufwändig manuell durchgeführt werden müsste (BGH, Urteil vom 19.4.2007 – I ZR 35/04 – Internet-Versteigerung II) . Dem Betreiber einer Handelsplattform kann es nicht zugemutet werden, nach Rechtsverletzungen zu suchen, die nur durch eine aufwändige manuelle Prüfung auffindbar wären. Der Einsatz einer Suchsoftware ist einem Plattformbetreiber bei Markenrechtsverletzungen auch in aller Regel zumutbar. Was zumutbar ist, entscheidet letztendlich auch der Charakter des Plattformbetreibers: Der Betreiber eines Forums, das überwiegend nichtgewerbliche Zwecke verfolgt, hat geringere Prüfpflichten, als der Betreiber eines Portals, der in erster Linie eine Plattform zur zielgruppenorientierten Platzierung für seine Werbepartner zur Verfügung stellt und sich umfangreiche Nutzungsrechte seiner Nutzer zur Weiterverwertung abtreten lässt.
Bundesgerichtshof: Der Plattformbetreiber muss nicht die Arbeit übernehmen, die der Schutzrechtsinhaber selbst übernehmen könnte
Wer seinen Nutzern aber selbst Software zur Überprüfung von Rechtsverletzungen zur Verfügung stellt, hat grundsätzlich geringere Prüfpflichten (BGH, Urteil vom 22.7.2010 – I ZR 139/08 – Kinderhochstühle im Internet). Stellt der Plattformbetreiber also eine Software zur Verfügung, mit dessen Hilfe ein Rechteinhaber selbst nach Rechtsverletzungen suchen kann, so muss er diese Arbeit nicht selbst übernehmen. Aus diesem Grund hatte der BGH die Klage eines Markenhändlers gegen eBay abgewiesen. Mit dieser Klage wollte man Auktionen für bestimmte Markenkinderstühle verhindern. Der BGH wies die Klage ab: Der Markeninhaber könne mit Hilfe des von eBay zur Verfügung gestellten VeRI-Programms ohne weiteres selbst nach markenrechtsverletzenden Angeboten suchen. Auch eine anschließende manuelle Kontrolle sei dem Markeninhaber zuzumuten. Eine solche manuelle Kontrolle sei eBay selbst aber nicht zuzumuten und würde das gesamte Geschäftsmodell in Frage stellen. Wer also seinen Nutzern eine geeignete Software zur Überprüfung von Schutzrechtsverletzungen zur Verfügung stellt, kann seinen Aufwand zur Überprüfung erheblich reduzieren.
Die "Störerhaftung im europäischen Recht: Die "Mittelsperson"
EuGH v. 7.7.2016 – C-494/15 – Tommy Hilfiger u.a./Delta Center
Die Störerhaftung gitl im Grundsatz auch im europäischen Recht. Ein Beispiel:
Die Antragsgegnerin vermietet die „Prager Markthallen“ an verschiedene Händler. Tommy Hilfiger und andere Markenhersteller stellten fest, dass dort auch Produktfälschungen angeboten wurden. Sie beantragten beim Stadtgericht Prag, es der Beklagten zu verbieten, Mietverträge mit Personen abzuschließen oder zu verlängern, die bereits wegen Markenverletzung verurteilt worden waren. Außerdem wollten die Antragsteller die Beklagte zwingen, in den Händlermietverträgen entweder eine Klausel aufzunehmen, wonach sich die Händler (Mieter) verpflichten, keine Schutzrechte zu verletzen oder diese Händlerverträge jedenfalls gekündigt werden können, wenn die Händler Schutzrechte verletzen. Das Stadtgericht Prag wies den Antrag zurück, ebenso das Prager Obergericht. Hiergegen wandten sich die Antragsteller zum Obersten Gerichtshof.
Haftet ein Vermieter von Marktständen für Rechtsverletzungen der Standbetreiber?
Der Oberste Gerichtshof in Tschechien legte dem EuGH die Frage vor, ob ein Vermieter von Marktständen eine „Mittelsperson“ im Sinne des Art. 11 S. 3 der Enforcement-Richtlinie (Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums) ist. Nach dieser Vorschrift müssen die EU-Mitgliedsstaaten sicherstellen, dass Schutzrechtsinhaber auch gegen Mittelspersonen vorgehen können, wenn deren Dienste zum Zweck der Schutzrechtsverletzungen (z.B. Marken oder Geschmacksmuster/Designs) in Anspruch genommen werden. Diese Bestimmung wurde durch das Gesetz 221/2006 in tschechisches Recht umgesetzt. Eine wörtliche Umsetzung in das deutsche Recht fehlt zwar. Im deutschen Recht werden derartige Fälle aber über die sog. „Störerhaftung“ gelöst (hierzu oben). Außerdem wollt der Oberste Gerichtshof wissen, ob ein Vermieter von Marktständen, an denen Schutzrechtsverletzung stattfinden, gezwungen werden kann, neuerliche Schutzrechtsverletzungen zu verhindern.
Ist der Vermieter von Marktständen mitverantwortliche „Mittelsperson“ bei der Verletzung von Schutzrechten des geistigen Eigentums?
Der EuGH stellte zunächst fest, dass eine solche „Mittelsperson“ nicht notwendigerweise ein besonderes Verhältnis zum Schutzrechtsverletzer pflegen muss. Auch der Umstand, dass Delta Center eine andere Dienstleistung anbot (nämlich Vermietung von Marktständen) als die Schutzrechtsverletzer (Anmietung von Marktständen) spielte keine Rolle. Denn die Mittelsperson müsse nicht die gleichen Dienstleistungen anbieten, wie der Schutzrechtsverletzer, so der EuGH. Das hat der EuGH bereits in den Fällen der Haftung von Acesss-Providern (Internetzugangsanbietern) entschieden (z. B. EuGH v. 27.3.2014, C-314/12 – UPC Telekabel Wien). Auch sei der Anwendungsbereich der Enforcement-Richtlinie nicht auf den elektronischen Handel beschränkt. Auch der Vermieter von Marktständen, an denen Schutzrechtsverletzungen stattfinden, könne daher als „Mittelsperson“ haften, so der EuGH.
Muss die Mittelsperson auch neuerliche Rechtsverletzungen verhindern?
Mit der Antwort auf die zweite Vorlagefrage des Obersten Gerichtshof in Tschechien hat der EuGH seine Rechtsprechung zur Haftung von Onlinemarktplätzen (z.B. eBay, Amazon) im Prinzip auf die Haftung von physichen Marktplätzen übertragen. Der Oberste Gerichtshof wollte wissen, ob dem Vermieter von Marktständen, an denen Schutzrechtsverletzungen stattfinden, bestimmte Maßnahmen auferlegt werden können, um künftige Rechtsverletzungen zu verhindern. Der EuGH wies darauf hin, dass er entsprechende Pflichten den Betreibern von Onlinehandelsplätzen bereits auferlegt hat (EuGH v. 12.7.2011, C-324/09 – Lóréal/eBay). Solche Pflichten dürften zwar nicht unangemessen sein. Beispielsweise muss kein Betreiber von Marktplätzen seine Kunden generell und ständig überwachen. Was den Umfang der Verantwortung des Marktplatzbetreibers anging, verwies der EuGH in vollem Umfang auf sein Urteil v. 12.7.2011, C-324/09 – Lóréal/eBay. In dieser Entscheidung stellte der EuGH klar, dass der Betreiber eines Online-Marktplatzes nicht nur die ihm bekannt gewordenen Verletzung von Schutzrechten abstellen muss. Er muss darüber hinaus auch Maßnahmen ergreifen, um erneute gleichartige Verletzungen verhindern (EuGH v. 12.7.2011, C-324/09 – Lóréal/eBay, Rz. 144). Diese Grundsätze gelten nach dem aktuellen Urteil des EuGH auch für die Betreiber von physischen (stationären) Märkten, beispielsweise für Vermieter von Marktständen auf einem Markt.