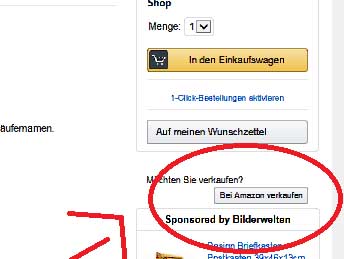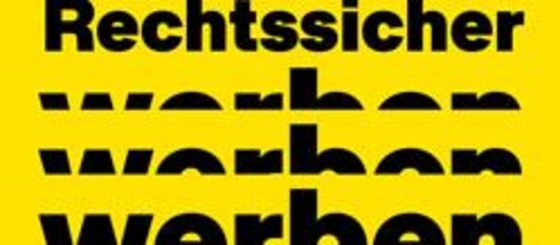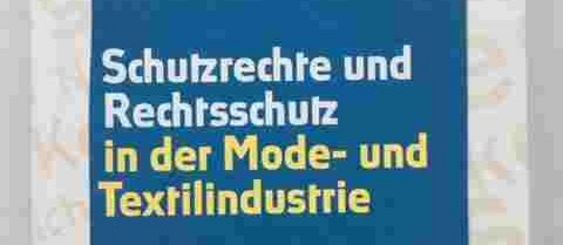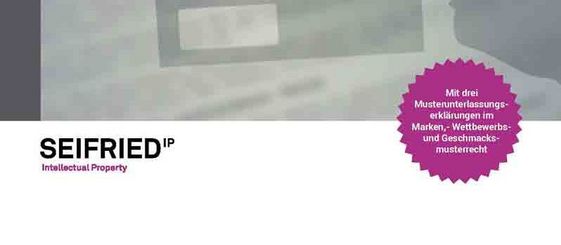Autor: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Ihr Rechtsanwalt
Kostenlose Ersteinschätzung
Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Thomas Seifried, seit 2007 auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, hat über 20 Jahre Erfahrung im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Designrecht mit vielen nachweisbaren Erfolgen.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Wir melden uns umgehend
0800 8765544
(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)
Wir behandeln alle Unterlagen streng vertraulich.
Unsere Ersteinschätzung ist stets kostenlos.
Praktikerhandbuch zum Werberecht von Thomas Seifried
„Rechtssicher werben", 2. neubearbeite Auflage 2023, 232 Seiten, XchangeIP Verlag, im Buchhandel oder bei Amazon
Praktikerhandbuch für die Modeindustrie von Thomas Seifried und Dr. Markus Borbach
„Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie", 368 Seiten, erschienen 2014 in der dfv-Mediengruppe
Kostenloser Download "Abgemahnt - Die Taschenfibel 2021"
Alles über Abmahnungen und strafbewehrte Unterlassungserklärungen, als ePUB oder PDF
Haftet ein Amazon-Händler für Rechtsverletzungen auf der von Amazon generierten Produktdetailseite?
Haftung für Wettbewerbsverstöße (z.B. unlautere Werbung)
Ein Händler kann für Angaben einer Verkaufsplattform, der er sich bedient, haften auch wenn nicht er, sondern die Verkaufsplattform diese Angaben eingestellt hat. Das gilt zunächst für wettbewerbsrechtliche Fälle, beispielsweise für Fälle unlauterer geschäftlicher Handlungen. Beispielsweise haften Amazon-Händler für unrichtige unverbindliche Preisempfehlungen auf Amazon, auch wenn diese die UVP gar nicht eingestellt haben.
Beispiel
Die Beklagte bot auf amazon.de eine Uhr der Marke „Casio“ zu 19,90 Euro an. Über der Preisangabe war der Hinweis angebracht
„Unverb. Preisempf.“ und dahinter die durchgestrichene Angabe „39,90 Euro“.
Die Angabe war falsch. Tatsächlich handelte es sich um ein Auslaufmodell. Im Zeitpunkt des Angebots bestand diese Herstellerpreisempfehlung nicht mehr. Die beanstandete Preisempfehlung hatte Amazon eingestellt. Hierfür haftete dennoch der Händler. Denn die Zurechnung der Gefahr, in dieser Konstellation für falsche Angaben Dritter (d. h. Amazon) zu haften, ist gleichsam die Kehrseite der von den Händlern in Anspruch genommenen Vorteile einer „internetbasierten, allgemein zugänglichen und eine weitge-hende Preistransparenz vermittelnden Verkaufsplattform“ (BGH v. 3.3.2016 - I ZR 110/15 - Herstellerpreisempfehlung bei Amazon).
Haftung für Markenrechtsverletzungen
Ein Onlinehändler, der auf einer Verkaufsplattform anbietet, kann auch für Markenrechtsverletzungen haften, die dadurch entstehen, dass ein anderer Händler das Angebot ändert. Das Gleiche gilt, wenn dies der Betreiber der Verkaufsplattform, beispielswiese Amazon, tut.
Beispiel
Der Beklagte bot auf dem Amazon-Marketplace eine „Finger Maus“ für Notebooks an. Ursprünglich enthielt die Angebotsseite die Herstellerbezeichnung „Oramics“. Später wurde das Angebot geändert in:
„Trifoo [...] Finger Maus [...]“
Die Klägerin wurde erst nach der Angebotseinstellung Inhaberin der Marke „TRIFOO“. Das Angebot war dennoch eine Verletzung der Marke „Trifoo“. Der Beklagte haftet als „Störer“. Denn das Einstellen auf Amazon ist ein „gefahrerhöhendes Verhalten“: Wer auf dem Marketplace anbiete, muss ständig damit rechnen, dass die Angebotsseite verändert wird und er dadurch fremde Rechte verletzt werden. Ein Marketplace-Händler muss daher „ein bei Amazon Marketplace eingestelltes Angebot regelmäßig darauf [...] überprüfen, ob rechtsverletzende Änderungen vorgenommen worden sind“ (BGH v. 3.3.2016 – I ZR 140/14 – Angebotsmanipulation bei Amazon).
Lesen Sie hier: Haftung der Amazon-Händler für Urheberrechtsverletzungen, z.B. Produktbilder
Prüfpflicht des Amazon-Händlers alle zwei Wochen
Nach der Rechtsprechung des BGH muss ein Amazon-Händler ein bei Amazon Marketplace eingestelltes Angebot öfter als einmal alle zwei Wochen auf Rechtsverletzungen hin überprüfen (BGH v. 3.3.2016 - I ZR 140/14 - Angebotsmanipulation bei Amazon, Rz. 30). Auch die Beklagte habe überprüfen müssen, welche Lichtbilder mit der ASIN verlinkt waren, um sich zu vergewissern, ob ihr eine Nutzung derselben erlaubt ist, um einer urheberrechtlichen Haftung zu entgehen. Dies sei ihr auch grundsätzlich möglich, da jeder Internetnutzer (also auch Mitarbeiter der Beklagten) in der Lage sei, durch Eingabe einer URL, die die ASIN des Produkts enthält, die hinterlegten Produktinformationen einzusehen.
Das Urteil des OLG Köln steht im Widerspruch zu dem Urteil des OLG München in einem ähnlichen Fall. In diesem hatte das OLG München ein öffentliches Zugänglichmachen des Amazon-Händlers und damit eine Urheberrechtsverletzung verneint (OLG München v. 10.03.2016 – 29 U 4077/159). Das OLG Köln hat daher eine Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.
Das nachträgliche Einfügen der eigenen Marke kann rechtsmissbräuchlich oder wettbewerbswidrig sein
OLG Frankfurt v. 27.10.2011 – 6 U 179/10
Manchmal ändert ein Anbieter eine Produktseite, indem er selbst seine eigene Marke einfügt. In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt (Urteil v. 27.10.2011 – 6 U 179/10) entschiedenen Fall hatte ein solcher Anbieter anschließend einen Konkurrenten wegen Verletzung seiner Marke verklagt. Zu Unrecht, meinte das OLG: Es läge zwar an sich eine Markenrechtsverletzung vor, weil der Unterlassungsanspruch verschuldensunabhängig sei. Ein solches Vorgehen sei aber rechtsmissbräuchlich. Denn dieser Anbieter habe seinen Konkurrenten bewusst in die Falle laufen lassen. Die Besonderheit des Falls: Über 1 1/2 Jahre lang hätten beide Anbieter nebeneinander die gleichen Brillen unter dieser Produktseite verkauft. Wenn er nun seine eigene Marke in das Angebot einfüge, müsse er seine Konkurrenten wenigstens darüber informieren, meinte das OLG Frankfurt.
LG Frankfurt v. 11.5.2011, Az. 3-08 O 140/10
Noch strenger sah dies das Landgericht Frankfurt in einem Urteil vom 11.5.2011 (Az. 3-08 O 140/10). Die Parteien des bereits erwähnten Verfahrens vor dem OLG Hamm stritten in Frankfurt darum, ob nicht selbst wettbewerbswidrig handele, wer nachträglich seine Marke in die Produktseite einfüge, um anschließend gegen Konkurrenten wegen Verletzung dieser Marke vorzugehen. Das Landgericht Frankfurt hatte genau dies angenommen: Wenn über fünf Monate hinweg die Produktseite unverändert geblieben war, könne man nicht plötzlich eine Marke einfügen und mit dieser gegen Mitbewerber markenrechtlich vorgehen. Das sei eine wettbewerbswidrige gezielte Behinderung. Die Entscheidung ist nicht ohne Weiteres verallgemeinerungsfähig. Denn an sich muss ein Amazon-Verkäufer regelmäßig die Produktseiten überprüfen. Das OLG Hamm nimmt an, dass ein Amazon-Händler seine Produktseiten nicht länger als drei Tage aus den Augen lassen dürfe. Die Amazon-AGB selbst sehen sogar eine tägliche Prüfpflicht vor. Nicht selten hängen sich Verkäufer auf Amazon an vorgeschlagene Artikel auch dann an, wenn sie tatsächlich nicht ein identisches, sondern nur ein ähnliches Produkt verkaufen wollen. Das erspart ihnen die mühevolle Erstellung einer eigenen Produktseite. Wer aber ein anderes Produkt liefert, als auf der Amazon-Produktseite dargestellt, verstößt gegen das Wettbewerbsrecht (OLG Hamm v. 19.7.2011 – I-4 U 22/11).
Sie haben eine markenrechtliche oder kennzeichenrechtliche Abmahnung erhalten?
Wenn der Abmahnende eine Verletzung seiner Marke oder seines Unternehmenskennzeichens durch das "Anhängen" an eine existierende Produktseite behauptet, kommt es darauf an, ob der beanstandete Markenbestandteil überhaupt geschützt ist und ob dann eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Oft ist bei Wortbildmarken der Wortbestandteil überhaupt nicht schutzfähig. Es kommt auch darauf an, wie genau die Marke oder das Kennzeichen benutzt wurde. Es kommt auch darauf an, ob der Abmahnende aus einer deutschen Marke oder einer Unionsmarke vorgeht.
Aufbau, Diktion und vor allem die vorformulierte Unterlassungserklärung verraten uns, ob die geltend gemachten Ansprüche berechtigt und durchsetzbar sind und der Gegenanwalt auf der Höhe der aktuellen Rechtsprechung ist. Wir haben jahrelange Erfahrung und nachweisbare Erfolge im Marken- und Kennzeichenrecht, auch in komplizierten Markenrechtsfällen.
Sie haben sich an eine Amazon-Produktseite angehängt?