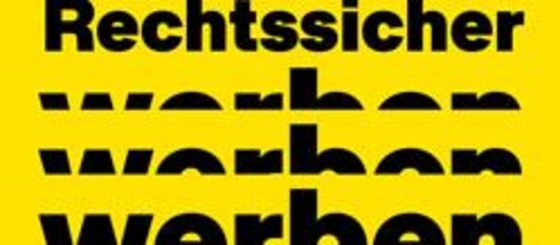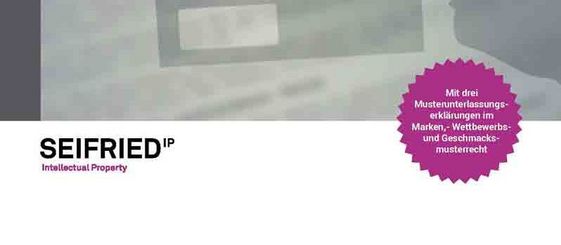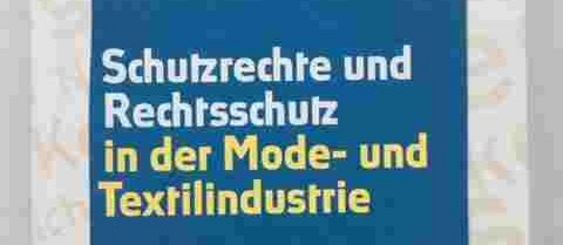Autor: Anwalt für Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried
Ihr Rechtsanwalt
Kostenlose Ersteinschätzung
Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Thomas Seifried, seit 2007 auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, hat über 20 Jahre Erfahrung im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Designrecht mit vielen nachweisbaren Erfolgen.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Wir melden uns umgehend
0800 8765544
(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)
Wir behandeln alle Unterlagen streng vertraulich.
Unsere Ersteinschätzung ist stets kostenlos.
Praktikerhandbuch zum Werberecht von Thomas Seifried
„Rechtssicher werben", 2. neubearbeite Auflage 2023, 232 Seiten, XchangeIP Verlag, im Buchhandel oder bei Amazon
Kostenloser Download "Abgemahnt - Die erste-Hilfe-Taschenfibel 2021" als ePUB oder PDF
Alles über Abmahnungen und strafbewehrte Unterlassungserklärungen
Praktikerhandbuch für die Modeindustrie von Thomas Seifried und Dr. Markus Borbach
„Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie", 368 Seiten, erschienen 2014 in der dfv-Mediengruppe
Definition Geschäftsgeheimnis nach dem GeschGehG
Ein Geschäftsgeheimnis war vor Inkrafttreten des GeschGehG jede im Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb stehende Tatsache, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis bekannt ist und nach dem bekundeten, auf wirtschaftlichen Interessen beruhenden Willen des Betriebsinhabers geheimgehalten werden soll (vgl. KG v. 10.11.2020 - 6 W 1029/20; BGH v. 26.2.2009, I ZR 28/06 Rn. 13 – Versicherungsuntervertreter).
Mit Inkrafttreten des GeschGehG ist nach § 2 Nr. 1 GeschGehG ein Geschäftsgeheimnis eine Information, die
a) weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und die
b) Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und bei der
c) ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht.
Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.
"Allgemein bekannt" ist eine Information, wenn sie zum gängigen Kenntnis- und Wissensstand der breiten Öffentlichkeit oder einer dem maßgeblichen Fachkreis angehörenden durchschnittlichen Person gehört. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Information der interessierten Öffentlichkeit bzw. dem maßgeblichen Fachkreis durch Veröffentlichung, Anmeldung oder Registrierung eines Schutzrechts oder Ausstellung bekannt gemacht wurde (OLG Düsseldorf 11.03.2021 - 15 U 6/20, Rn. 31). Ohne weiteres zugänglich sind Informationen, die jede Person bzw. die maßgeblichen Fachkreise ohne besondere Schwierigkeiten d.h. ohne größeren Zeit- und Kostenaufwand erschließen und nutzen können (OLG Düsseldorf 11.03.2021 - 15 U 6/20, Rn. 32; OLG Düsseldorf 04.02.2021 - 15 U 37/20, Rn. 23). Schutzwürdig sind insbesondere Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Bezugsquellen, Konditionen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulationsunterlagen, Patentanmeldungen und sonstige Entwicklungs- und Forschungsprojekte. Auch Vertragsgestaltungen, Zeichnungen, Planungsunterlagen und Modelle von technischen Bauten oder Geräten können geschützt sein (Verwaltungsgericht Aachen, Urteil vom 8. August 2022 - 8 K 4232/18, zur Definition von Geschäftsgeheimnissen nach § 2 GeschGehG).
Inhaber des Geschäftsgeheimnisses
Inhaber des Geschäftsgeheimnisses ist derjenige, der die rechtmäßige Kontrolle hierüber hat (vgl. § 2 Nr. 2 GeschGehG). Klassische Geschäftsgeheimniss sind Kundendaten und Kundenlisten (vgl. BGH v. 27.4.2006, I ZR 126/03 - Kundendatenprogramm). Auch private Aufzeichnungen eines Vertriebsmitarbeiters in seinem Kalender zu Kundenbesuchen können Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebes sein (vgl. LAG Düsseldorf v. 3.6.2020 - 12 SaGa 4/20).
Technische Geschäftsgeheimnisse sind beispielsweise Konstruktionen, Konstruktionszeichnungen, Rezepte, Herstellungsverfahren, technische Zusammensetzungen sowie die Funktionsweise einer Anlage. Wenn die betreffende Tatsache zum Stand der Technik gehört, gilt dies, wenn sie jedenfalls nur mit einem großen Zeit- oder Kostenaufwand ausfindig, zugänglich und nutzbar gemacht werden kann (BGH, Urt. v. 22.3.2018 – I ZR 118/16 – Hohlfasermembranspinnanlage II).
Mitnahme von Geschäftsgeheimnissen durch ehemalige Arbeitnehmer
Die praktisch häufigsten Fälle von Verstößen gegen das GeschGehG betreffen ausgeschiedene Arbeitnehmer. Rechtlich irrelevant ist es, ob Arbeitnehmer die Geschäftsgeheimnisse bereits vor oder erst nach ihrem Ausscheiden genutzt haben. Denn die Berechtigung, erworbene Kenntnisse nach Beendigung des Dienstverhältnisses auch zum Nachteil des früheren Dienstherrn einzusetzen, bezieht sich nicht auf Informationen, die dem ausgeschiedenen Mitarbeiter nur deswegen noch bekannt sind, weil er auf schriftliche Unterlagen zurückgreifen kann, die er während der Beschäftigungszeit angefertigt hat (BGH v. 19.12.2002, I ZR 119/00 - Verwertung von Kundenlisten). Liegen dem ausgeschiedenen Mitarbeiter solche schriftliche Unterlagen - beispielsweise in Form privater Aufzeichnungen oder in Form abgespeicherten Daten - vor, und entnimmt er ihnen ein Geschäftsgeheimnis seines früheren Arbeitgebers, dann verschafft sich dieses Geschäftsgeheimnis unbefugt (BGH, Urteil vom 27. 4. 2006 - I ZR 126/03 - Kundendatenprogramm) und verwertet diese unbefugt (BGH, Urt. v. 22.3.2018 – I ZR 118/16 – Hohlfasermembranspinnanlage II). Das gilt auch dann, wenn der Nutzer in der Lage ist, solche Dokumente selbst zu entwickeln (vgl. BGH, Urt. v. 22.3.2018 – I ZR 118/16 – Hohlfasermembranspinnanlage II).
Die Verwertung wiederum setzt keine identische Benutzung des Geheimnisses voraus. Es genügt, wenn die unbefugt erlangten Kenntnisse in einer Weise mitursächlich geworden sind, die wirtschaftlich oder technisch nicht als bedeutungslos angesehen werden kann (vgl. BGH GRUR 2002, 91, 93 - Spritzgießwerkzeuge).
Kein Schutz nach GeschGehG ohne angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen
Eine wesentliche Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage nach dem UWG steht in § 2 Nr. 1 b) GeschGehG: Eine Information ist nur dann ein geschütztes Geschäftsgeheimnis, wenn sie „Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ ist. Ohne Schutz ist eine Information kein schutzfähiges Geschäftsgeheimnis. Zwar sollen an die Anforderungen an angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen keine überzogenen Anforderungen gestellt werden. Es muss aber aktive Schutzmaßnahmen geben, beispielsweise ein passwortgeschützter Datenzugang (vgl. KG v. 10.11.2020 - 6 W 1029/20). Wer zulässt, dass Dateien mit Geschäftsgeheimnissen auf privaten Datenträgern gespeichert werden, muss damit rechnen, dass seine Geheimhaltungsmaßnahmen nicht als angemessen angesehen werden (vgl. OLG Stuttgart v. 19.11.2020 - 2 U 575/19 - Schaumstoffsysteme). Auch wer Hinweise hat, dass seine Geheimhaltungsmaßnahmen umgangen werden, und hierauf nicht reagiert, muss damit rechnen, dass dessen Geheimhaltungsmaßnahmen nicht als angemessen angesehen werden. Wer solche Hinweise erhält, muss diesen vielmehr nachgehen und seine Geheimhaltungsmaßnahmen anpassen (OLG Hamm v. 15.9.2020 - 4 U 177/19 - Nachahmung eines Stopfaggregats).
Verschwiegenheitsklauseln als Geheimhaltungsmaßnahme
Verschwiegenheitsverpflichtungen der betreffenden Arbeitnehmer sind an sich als Geheimhaltungsmaßnahmen geeignet (vgl. OLG Stuttgart v. 19.11.2020 - 2 U 575/19 - Schaumstoffsysteme). Oft sind Verschwiegenheitsverpflichtungen Bestandteil des Arbeitsvertrags. Ob das als angemesse Geheimhaltungsmaßnahme ausreicht, hängt von dem Inhalt der betreffenden Geheimhaltungsklausel ab. Wenn diese nur ganz allgemein alle betriebsinternen Vorgänge als geheimhaltungsbedüftig beschreibt, ohne bestimmte geheimhaltungsbedüftige Informationen zu definieren, reicht das nicht aus. Denn solche Formulierungen sind inhaltsleer und konterkarieren den Begriff des Geschäftsgeimnisses (vgl. LAG Düsseldorf v. 3.6.2020 - 12 SaGa 4/20).
Mittelbare Geheimnisverletzung, § 4 Abs. 3 GeschGehG
Eine unzulässige mittelbare Geheimnisverletzung begeht, wer ein Geschäftsgeheimnis über eine andere Person erlangt hat und weiß oder wissen müsste, das diese Person das Geschäftsgeheimnis unbefugt genutzt oder offengelegt hat (§ 4 III GeschGehG). Ein „Erlangen“ erfodert ein „aktives Element“. Nur wer eine Geschäftsgeheimnis erlangt und zumindest hätte wissen müssen, dass derjenige, von dem er es erlangt, einen Rechtsverstoß begangen habe, verstößt selbst gegen das Gesch-GehG. Wer beispielsweise Geschäftsgeheimnisse ungefragt per Email erhält, ohne von dem Rechtsverstoß des Absenders zu wissen, verstößt nicht selbst gegen das GeschGehG. (OLG Frankfurt vom v. 27.11.2020 - 6 W 113/20 - Unterlassungsansprüche nach dem GeschGehG im Eilverfahren).
Umfang des Schadenersatzes bei der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen
Wer ein Geschäftsgeheimnis verletzt, muss grundsätzlich den gesamten unter Einsatz des geheimen Know-hows erzielten Gewinn herausgeben (BGH v. 19.3.2008, I ZR 225/06 – Umfang des Schadenersatzes bei Verletzung von Betriebsgeheimnissen).