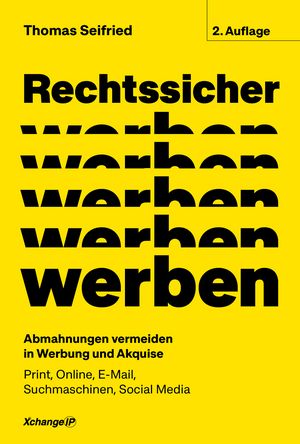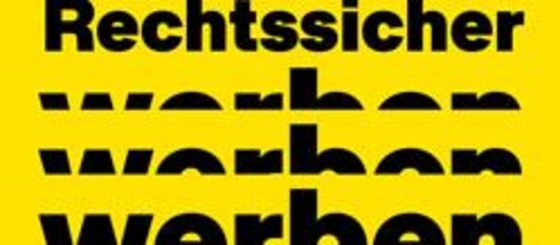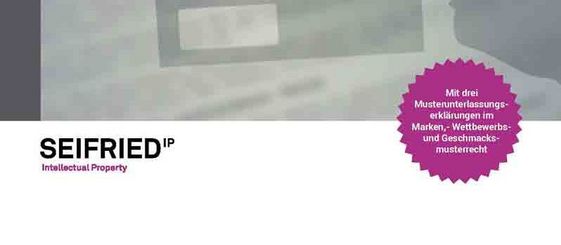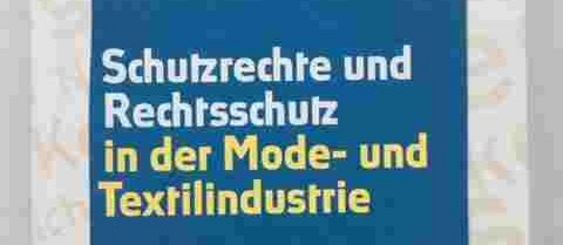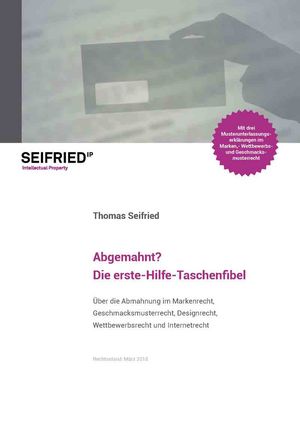Was ist eine Werbe-E-Mail?
„Werbung“ ist jede gewerbliche Äußerung, die auf eine Absatzförderung gerichtet ist, auch mittelbar (BGH v. 15.12.2015 – VI ZR 134/15). Werbung ist z.B. ein Kundennewsletter, eine Werbung mit einem Gutschein in einer Bestellbestätigung oder eine Kundenzufriedenheitsumfrage. Dementsprechend ist auch eine Einladungs-Email, die Facebook an Empfänger sendet, die nicht Mitglieder des sozialen Netzwerks sind und in den Erhalt der Emails nicht ausdrücklich eingewilligt haben eine „Werbung“ und dementsprechend eine unzumutbare Belästigung im Sinne des § 7 II Nr. 2 UWG (BGH v. 14.01.2016 – I ZR 65/14 – Freunde finden). Werbung ist es daher auch, wenn nach einem Kauf auf dem Amazon-Marketplace der Verkäufer dem Käufer per Email die Rechnung schickt und diesen gleichzeitig auffordert, ihm eine 5-Sterne Bewertung zu geben (BGH vom 10.7.2018 - VI ZR 225/17). Demensprechend kann eine solche E-Mail-Werbung eine Abmahnung im Wettbewerbsrecht auslösen.
Einwilligung durch „einfachen Opt-In“ riskant
Beim einfachen Opt-In stimmt man zu, regelmäßige Nachrichten – meist E-Mails oder auch SMS – zu empfangen. Das geschieht, indem man sich einmal in eine Abonnentenliste (z. B. in einem Webformular) einträgt. Das Problem bei einfachem Opt-Ins: Man kann dort auch fremde Kontaktdaten eintragen. Beim einfachen Opt-In besteht also immer die Gefahr, dass Eintrag tatsächlich nicht vom Empfänger stammt. Nachzuweisen hat die Einwilligung im Prozess aber immer der, der sich auf sie beruft.
Einwilligungen durch Double-Opt-In
Wer Emailwerbung versendet, tut dies deshalb meist an Adressaten, die im Double-Opt-In-Verfahren generiert wurden: Wer den Emailnewsletter erhalten möchte, meldet sich unter Angabe seiner Emailadresse in einem Webformular an. Anschließend erhält er eine Bestätigungsemail, mit der er aufgefordert wird, durch seine Emailadresse zu bestätigen, indem er eine verlinkte Landingpage aufruft. Dies galt als sicherster Weg, um die erforderliche Einwilligung in den Erhalt von Werbeemails nachzuweisen. Auch die erstinstanzliche Rechtsprechung hatte diese erste Bestätigungsemail noch nicht selbst als wettbewerbswidrige unzumutbare Belästigung bzw. als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb angesehen (z.B. LG Berlin v. 30.11.2007, Az. 15 O 346/06; AG München v. 30.11.06, Az.161 C 29330/06).
Das Oberlandesgericht München allerdings hielt schon die allererste Bestätigungsemail für einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wenn eine Einwilligung in den Erhalt der Bestätigungsemail(!) nicht nachgewiesen werden kann (OLG München v. 27.09.2012 – 29 U 1682/12 - Bestätigungsaufforderung). Andere Oberlandesgerichte teilen diese Auffassung nicht. Sie gehen vielmehr davon aus, dass alleine der Empfang einer Bestätigungsemail selbst noch keine Werbung ist OLG Celle v. 15.05.2014 - 13 U 15/14; OLG Düsseldorf, vom 17.03.2016 - I-15 U 64/15 - Werbeanfragen im Reisebuchungssystem).
„Inbox Advertising“ in Webmails
Auch dann, wenn Werbe-E-Mails in einem E-Mail-Konto als Webanwendung (Webmail-Konto, z. B. „Freemail“ von Telekom) eingeblendet werden, ist eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Nutzers nötig.
Beispiel
Im Auftrag einer Werbeagentur ließ ein Stromlieferant Werbung für Strom und Gas schalten. Dabei wurde in den kostenfreien E-Mail-Postfächern der Nutzer des E-Mail-Dienstes von T-Online Werbebanner eingeblendet („In-box Advertising“). Diese unterschieden sich im Aussehen von der Liste der eingeblendeten E-Mails des Nutzers nur dadurch, dass sie grau unterlegt und kein Absender angegeben war und statt des Datums der Text „Anzeige“ erschien.“ Das ist wettbewerbswidrig, wenn der Nutzer dem Anbieter des E-Mail-Dienstes nicht zuvor eine Einwilligung für eine solche Werbung erteilt hatte (EuGH v. 25.11.2021 – C-102/20 – StWL/eprimo). Eine allgemeine Einwilligung in den Empfang von Werbung genügt jedenfalls nicht. Die Einwilligung des E-Mail-Nutzers muss sich vielmehr auch darauf beziehen, dass Werbung in der Liste der angezeigten Eingangs-E-Mails angezeigt wird (BGH v. 13.1.2022 – I ZR 25/19 – Anforderung an wirksame Einwilligung in Inbox-Werbung).
Einwilligungserklärungen in AGB
Einwilligungserklärungen werden gerne in Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommen. Das ist grundsätzlich zulässig (BGH, Urteile vom 14. März 2017 - VI ZR 721/15; BGH, Urteil vom 25.10.2012 - I ZR 169/10 – Einwilligung in Werbeanrufe II). Damit eine solche vorformulierte Einwilligungserklärung wirksam ist, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:
Besondere Hervorhebung der Einwilligungserklärung
Eine Einwilligungserklärung muss gegenüber den übrigen Klauseln hervorgehoben werden, so dass sie “von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist“ (siehe 7 II DSGVO, ErwG 42 DSGVO) werden. Denn sie ist zugleich eine Einwilligung in die Nutzung von personenbezogenen Daten nämlich der Emailadresse. Eine solche Hervorhebung kann z.B. durch Fettdruck geschehen.
Keine „Opt-out“-Einwilligung durch bloße Untätigkeit
Der Empfänger muss aktiv einwilligen, d. h. mit einer „Opt-In“-Erklärung. Ein bereits gesetztes Häkchen ist genauso unwirksam wie eine „Opt-Out“-Regelung, bei der man aktiv widersprechen muss.
Bsp.: Unwirksam ist daher die folgende Einwilligungserklärung (Beispiel nach BGH v. 16.7.2008, VIII ZR 348/06 – Payback)
[ ] Bitte hier ankreuzen, wenn die Einwilligung nicht erteilt wird
Notwendige Informationen vor Einwilligung
Der Adressat einer Emailwerbung muss „für den konkreten Fall in Kenntnis der Sachlage“ eingewilligt haben (BGH v. 1.2.2018 - III ZR 196/17 – Einwilligung in nachvertragliche Kundenberatung). Dem entspricht Art. 4 Nr. 11 DSGVO. Darin heißt es, dass eine Einwilligung „für den bestimmte Fall in informierter Weise“ abgegeben sein muss. Das heißt: Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn der Adressat zuvor darüber informiert wurde, welche Art von Werbung ihn erwartet. Die Einwilligung muss sich auf eben diejenige Werbung beziehen, mit der der Einwilligende bedacht werden soll.
Unwirksam ist daher die folgende Einwilligungsklausel in den AGB eines Anbieters von Freeware:
„Mit der Angabe seiner persönlichen Daten erklärt der Nutzer sein Einverständnis, dass er von F. M. Limited und den hier [es folgt eine Liste von 25 Unternehmen] genannten Sponsoren Werbung per E-Mail an die vom Nutzer angegebene E-Mail-Adresse erhält. Der Nutzer kann der werblichen Nutzung seiner Daten durch F. M. Limited jederzeit durch eine E-Mail an Info@f...-m...com widersprechen."
Denn hier ist nicht klar, welche Produkte beworben werden sollen (BGH v. 14.3.2017 – VI ZR 721/15).
Der Verbraucher muss aber auch wissen von welchem Unternehmen er mit welcher Werbung rechnen muss (BGH v. 14.3.2017 – VI ZR 721/15; BGH v. 25.10.2012 - I ZR 169/10 – Einwilligung in Werbeanrufe II). Unzulässig sind deshalb generelle Klauseln, mit denen der Empfänger in „interessante Angebote” aus jedem Waren- und Dienstleistungsbereich eingewilligt hat (OLG Köln, Urteil vom 29.4.2009 - 6 U 218/08).
Die Einwilligungserklärungsklausel darf auch nicht mit anderen Erklärungen (z.B. der Vertragsannahme) kombiniert werden (OLG München v. 21.07.2011 – 6 U 4039/10). Ebenso wenig darf von der Einwilligung die Vertragserfüllung abhängen (Art. 7 IV DSGVO).
Beispiel einer zulässigen Einwilligungserklärung in AGB:
[ ] Ich willige ein, dass
[der Werbende] meine personenbezogenen Daten zur Versendung von E-Mails mit Angeboten von [Art der Produkte] verarbeitet und nutzt. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen durch Klick auf den nachfolgenden Link.
Wirksam ist auch die folgende Einwilligung im Bestellprozess eines Telekommunikationsunternehmens:
„[ ] Ich möchte künftig über neue Angebote und Services der T. GmbH per E-Mail, Telefon, SMS oder MMS persönlich informiert und beraten werden. Ich bin damit einverstanden, dass meine Vertragsdaten aus meinen Verträgen mit der T. GmbH von dieser bis zum Ende des Kalenderjahres, das auf die Beendigung des jeweiligen Vertrages folgt, zur individuellen Kundenberatung verwendet werden. Meine Vertragsdaten sind die bei der T. GmbH zur Vertragserfüllung (Vertragsabschluss, -änderung, -beendigung, Abrechnung von Entgelten) erforderlichen und freiwillig abgegebenen Daten. [Es folgt ein Hinweis auf das Widerrufsrecht]"
Hier ist dem Einwilligendem der Inhalt klar: „Individuelle Kundenberatung“ ist im Kontext der gesamten Klausel und des Bestellprozesses seine eigene Beratung während und nach der Vertragslaufzeit und zwar für die Produkte des Telekommunikationsunternehmens. Diese sind dem Einwilligendem auch bekannt. Denn er hält sich ja gerade in einem Bestellprozess dieses Unternehmens auf. Er weiß daher, um welche Produkte es geht. Das reicht aus (BGH v. 1.2.2018 - III ZR 196/17 – Einwilligung in nachvertragliche Kundenberatung).